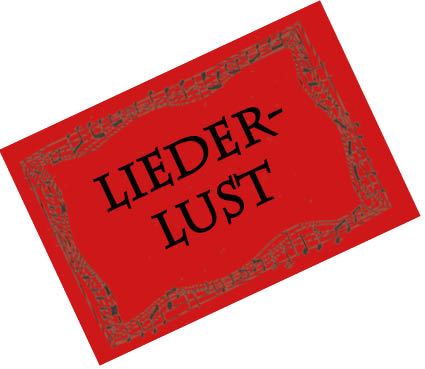
„Unverhofft kommt oft!“ Zum Beispiel Besuch, der unangekündigt vor der Tür steht. Auch wenn es vielleicht im ersten Moment den eigenen Tagesplan durcheinanderwirbelt, ein bisschen Zeit für ein kleines Schwätzchen findet sich immer. Und noch schöner ist es natürlich, wenn ein guter Freund oder eine Freundin so ganz spontan hereinschneit.
Ein Loblied auf solch einen Besuch ist unser neues Liederlustlied: das Lied vom Kanapee, das auch gleich Vorschläge zur Bewirtung parat hat: Will mich einmal ein guter Freund besuchen, so soll er mir willkommen sein, ich setz ihm vor den allerbesten Kuchen, dazu ein Glas Champagnerwein.
Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Befragungen mit älteren Sängerinnen und Sängern in Schwaben. Da stand ich auch oft unangekündigt vor der Tür. So auch bei meiner allerersten Befragung, die ich in der Nähe meines Heimatortes gemacht habe. Man erzählte mir von einem witzigen alten Sänger, Georg Niederwieser aus Unterwiesenbach, der meinen Kollegen bei einem Tanzabend aufgefallen war. Sie meinten, da müsste man dringend noch mal näher nachfragen und baten mich, ihn zu besuchen. Ich bin mit meinem Fahrrad los und habe an seiner Tür geklingelt. Unangemeldet, ich kannte ihn ja gar nicht. Leider war er nicht daheim, sondern im Nachbardorf auf einem Geburtstag der Verwandtschaft. Seine Angehörigen meinten, ich kann gerne dort vorbeischauen. Das hab ich dann tatsächlich gemacht. Wo ich doch eh schon unterwegs war. Ich bin dann mitten in den Geburtstagskaffeeklatsch geplatzt, aber niemand war erstaunt. Meine Frage nach alten Liedern hat mir sofort die Tür geöffnet. Ich wurde gleich an ihren Tisch gebeten und zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es wurde ein sehr lustiger Nachmittag.
Meine Erfahrungswerte waren damals noch eher gering und ich fand alles neu und spannend was mir meine Gewährsleute erzählt haben. Am meisten freute ich mich natürlich immer über Lieder, die ich so noch nicht gehört hatte, aber ich sammelte auch begierig jeden Liedfetzen auf, an den sie sich noch erinnern konnten. Auf diese Weise sind mir schon bald Fragmente des Kanapeeliedes über den Weg gelaufen. Fast jeder kannte es und erzählte mir davon. Es wurde wohl in den schwäbischen Wirtshäusern viel und gern gesungen. Leider konnten sich die meisten immer nur an Teile des Liedes erinnern. Oft ist es ja so, dass man ein Lied singen kann, wenn ein textsicherer ‚Vorsänger’ anstimmt, aber wehe, dieser fehlt.
Irgendwann hatten wir dann doch eine Variante mit drei Strophen beisammen und fingen an, das Kanapeelied bei Singstunden zu verbreiten. Und siehe da, es hatte seinen Zauber nicht verloren. Latent war es noch in den Köpfen vorhanden und so brauchte es nur einen kleinen Schubs. Bis heute ist das Kanapeelied das beliebteste Lied bei unseren Singstunden im Wasserschloss und ist regelmäßig an der Spitze der Top Ten bei der alljährlichen ‚Hitparade’.

Doch wie kam es eigentlich zu dieser weiten Verbreitung des Kanapeeliedes und wo kommt es her?
Der Musikwissenschaftler Lukas Richter hat hier näher nachgeforscht und dem Kanapeelied in seinem Buch ‚Der Berliner Gassenhauer’, das 1969 in Leipzig erschienen ist, ein kleines Kapitel gewidmet. Hier finden sich interessante Informationen:
‚Gassenhauer’ nennt man die Alltagslieder der Großstadt im 19. und frühen 20. Jh. Diese Gassenhauer ertönten auf den Straßen, Plätzen, Hinterhöfen, aus Kneipen und Tanzböden, aus Kammern und Werkstätten. Von der damaligen Forschung wurden diese populären Großstadtlieder nicht nur wenig beachtet, sondern sogar als minderwertig eingestuft. Auch dem Kanapeelied ist es so ergangen. Aber wir müssen noch einen Schritt zurückgehen, damit ihr das besser verstehen könnt:
Textfassungen des Kanapeeliedes sind schon ab der Mitte des 18. Jahrhunderts belegt. Eine Melodie dazu konnte dann 1840 in Thüringen aufgezeichnet werden. Diese Melodie ist eine völlig andere, als die, die heute bekannt ist. Im Text finden sich auch nur wenige Ähnlichkeiten zur heute bekannten Fassung, aber der Grundtenor ist der Gleiche – ein Loblied aufs Kanapee. Die größte Übereinstimmung sind die Schlusszeilen der letzten Strophe: Die Seele schwingt sich in die Höh, der Leib bleibt auf dem Kanapee.

Aufgezeichnet und veröffentlicht hat diese Fassung des Kanapeeliedes der berühmte Volksliedforscher und –sammler Franz Magnus Böhme (1827-1898) in seinem Werk „Volksthümliche Lieder der Deutschen im 18. Und 19. Jahrhundert. Nach Wort und Weise aus alten Drucken und Handschriften, sowie aus Volksmund zusammengebracht, mit kritisch-historischen Anmerkungen versehen (Leipzig 1985).
Die jüngere Fassung des Kanapeeliedes, die wir bis heute kennen, hat sich von den Singspielhallen in Berlin ab 1873 in ganz Deutschland verbreitet. Franz Magnus Böhme schreibt dazu wenig schmeichelhaft:
In einer um 1873 aufgetauchten süßlichen Umbildung hat sich das Kanapeelied bis zur Gegenwart erhalten. In Singspielhallen in Berlin entstand zur Tingeltangel-Zeit 1873 ein modernes Kanapeelied, ein elendes Machwerk nach einer neuen Melodie.
Dieses vernichtende Urteil konnte das Kanapeelied nicht aufhalten. Offenbar hat es einen Nerv getroffen. Es breitete sich rasant in ganz Deutschland aus. Abwandlungen als „Kanapee-Marsch-Trio“ mit Textunterlegungen lassen sich bereits 1882 für den Kölner Karvenal belegen. Auch Bayern war im Kanapeefieber und auch dort haben sich die Musikanten davon inspirieren lassen. Es finden sich in ihren Notensammlungen unzählige Kanapee-Märsche, -Polkas und –Schottische. Auch professionelle Gesangsgruppen, wie das Mediumterzett haben das Kanapeelied gesungen und über Funk bekannt gemacht.
Die ungeheure Popularität des Kanapeeliedes zeigt auch eine sehr lustige Strophe, die 1904 in Berlin gesungen wurde. Vermutlich war sie inspiriert von Vorführungen der damals sehr beliebten Variétés, bei der die ‚Dame ohne Unterleib’ zu den Sensationen zählte. Kreative Köpfe haben gleich eine Strophe dazu gedichtet – auf die Melodie das Kanapees:
Wir singen jetzt das Lied von jener Dame,
von jener Dame ohne Unterleib.
Erst dachte ich, es wäre nur Reklame,
doch jetzt tut mir die Dame herzlich leid,
denn ohne Unterleib,
o weh, o weh, o weh,
kann sie nicht sitzen auf dem Kanapee!
Diese Strophe, hat es, wie viele andere, die es auch noch zum Kanapee gibt, nicht in die Gegenwart geschafft. Am bekanntesten ist sicherlich auch noch die schlesische Fassung des Kanapees mit den Strophen:
Bei uns dahee, da wars so schee gemiitlich
und nirgends kunnt es scheener sein.
Wir taten uns am besten Essen giitlich
und schlachteten jed Kirm e Schwein.
Und in der Eck juchhee,
da stand ein Kanapee,
ein liebes, gutes aales Kanapee.
Und will mich dann ein guter Freund besuchen,
der soll mir stets willkommen sein.
Ich setz ihm vor a schlesisch Streiselkuchen,
und oft a Glasel Kumbratwein.
Da setz m’r uns juchhee,
gleich uff das Kanapee
und singen dreimal hoch das Kanapee!
Aber nun genug erzählt, jetzt wird es Zeit, das Kanapeelied einmal selbst zu singen. Macht es euch auf dem Kanapee gemütlich, am besten mit einem Glas Champagnerwein. So wie wir. Wir sitzen auf dem schönen Kanapee in der Stube der Kreisheimatstube in Stoffenried. Herzlichen Dank, dass wir dort aufnehmen durften.
Und nun wünschen wir euch viel Freude beim Anschauen, Zuhören und Mitsingen!
Dieses Liedblatt Herunterladen
Alle Beiträge zur LIEDERLUST findet ihr HIER.




2 Antworten
Das ist ja allerliebst! Sehr beschwingt!
Super, danke